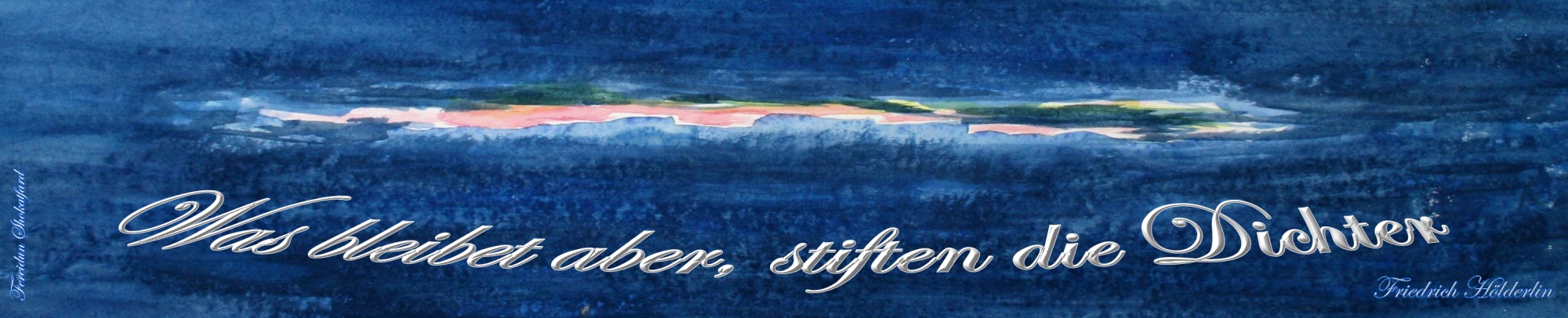Leseprobe aus „Liebe verstehen. Liebe leiden. Liebe dichten.”
Vorwort
Diotima: Der Name verbreitet noch immer seinen mythischen Zauber. Und auch die wenig geschätzte Tochter des Mythos, das Gerücht, tut seine Wirkung. Da war doch was mit dem Dichter Hölderlin und seiner Diotima. Aber wer ist sie gewesen? Erfundene Figur oder lebende Person? Hieß sie wirklich so, und wenn nicht, wie kam sie zu diesem Namen? Und welche Bedeutung hatte sie? Hat sie uns heute noch etwas zu sagen? Und was hat Platon mit alldem zu tun?Darum soll es im Folgenden gehen. Vorgestellt werden zwei Diotimen, einmal die des griechischen Philosophen Platon, dann die des Dichters Friedrich Hölderlin, wobei wir es damit schon genau genommen mit drei DiotimaFiguren zu tun haben, denn bei Hölderlin gibt es einmal die fiktive Diotima der Dichtungen und dann die realhistorische, die mit bürgerlichem Namen anders hieß und nur vom Dichter so genannt wurde. Dabei trage ich nicht zwei isolierte Monografien vor, sondern arbeite auch Bezüge zwischen den Werken heraus, kläre also, was Hölderlin von Platon übernommen und sich anverwandelt hat. Münden soll es in die Frage, ob etwas von dem hier Vorgestellten uns Heutige noch irgendetwas angeht.
Zunächst also zu Platon, dem Erfinder der Diotima. Sie hat ihren Auftritt in einem seiner berühmtesten Werke, dem Symposion, zu deutsch: Gastmahl. Und sie ist tatsächlich eine erfundene Figur. Es hat immer wieder Versuche gegeben, sie mit irgendwelchen geschichtlichen Personen zu identifizieren, keiner dieser Versuche ist überzeugend.
Welche Rolle spielt sie nun in diesem philosophischen Werk? Um dies zu klären, muss zunächst die gesamte Abhandlung in den Blick genommen werden.
Entstanden ist der Dialog Symposion um 380 v. Christus in Athen, er ist also 2500 Jahre alt, sein Autor Platon, der in Athen von 428 bis 347 vor Christus lebte, war ebensosehr Dichter wie Philosoph. Diese Doppelnatur muss man immer wieder betonen, da Platon sich ja, und das hat mit der Konstitution seines Denkens zu tun, wenig freundlich über Dichter geäußert hat: Oberflächenverliebt seien sie, deshalb unfähig, zum Wesen der Dinge vorzudringen. In gewisser Weise war er Dichter wider Willen. Dass er es aber eben doch war, zeigt sich schon daran, dass er die Liebe, von der sein Werk handelt, nicht zum Gegenstand eines theoretischen Diskurses macht, wie die Philosophen nach ihm, sondern in Gestalt des Eros mythologisiert.
Das Werk Symposion zeigt beide Seiten des poetischen Philosophen oder philosophischen Poeten. Es feiert einen Dichter, Agathon,karikiert einen anderen, Aristophanes, und führt hinein in die kalte Abstraktion der Ideenlehre, die alles Sinnliche hinter sich lässt, und formuliert am Schluss eine Lehre für gute Poesie. Die Werkstruktur ist einigermaßen vertrackt. Es handelt sich um eine doppelte Rahmenerzählung, die ihren eigentlichen Gegenstand, eben das Gastmahl, aus einer länger zurückliegenden Zeit hervorholt und präsentiert.