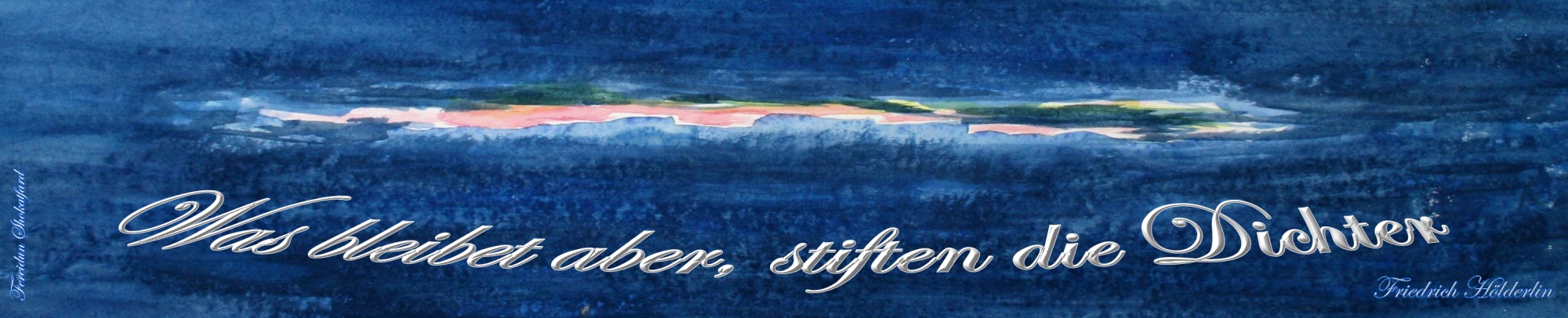Leseprobe aus „Daryl Dees Reise ans Ende der Welt”
Daryl Dees Reise ans Ende der Welt
Im April des Jahres 1568 lief Thomas Grisham, Sir Thomas, wie er sich seit einigen Jahren nennen durfte, einen jungen Mann mit sich zerrend, durch die Change Alley auf das Georgie’s zu.Der junge Mann, wir verraten, um den Leser nicht auf die Folter zu spannen und seine Geduld durch ewige Hinführungen, Wendungen, Verzögerungen und Irrwege auf eine allzu harte Probe zu stellen, seinen Namen: Daryl Dee. Daryl Dee, der Held unserer kleinen Geschichte sträubte sich nicht, hielt aber dem Tempo, das Sir Thomas vorlegte, kaum stand. Alles war ihm neu, die Straßen breit und übervoll von Menschen, Kutschen, wie er sie nie gesehen, mit schmalen, hohen Rädern, einachsig, zweiachsig, mit geschlossenen Karosserien oder offenem Verdeck, mit Laternen - Laternen! - zu beiden Seiten der Persenning, mit Fuhrmännern, die hinter dem Fahrgast stehen. Bisher kannte er, der nur wenige Kilometer von London entfernt die ersten zwanzig Jahre seines Lebens verlebt hatte, nur Ochsenkarren. Knarrende, hölzerne, an jeder nur möglichen Stelle ungeschickt ausgebesserte Kisten, die von schweren, behäbigen Tieren gezogen wurden. Er war, und das setzte ihn in Erstaunen, nicht nur in eine moderne Welt katapultiert worden, sondern in eine grundlegend andere. Hier in London war alles irritierend intakt, wären da nicht die Bettler, die Krüppel, die Kriegsversehrten, die immer wieder am Rand der Gasse auftauchten, Fremdkörper im Menschenstrom.
Und der Lärm: Ein endloses Brausen, ein Geschnatter und Gequatsche, ein Auf und Ab lauthals geäußerter Wörter, unzusammenhängend; jeder übertönte jeden, jeder wollte von allen gehört werden. Hinzu kam der Krach der Kutschen, deren 15 Räder ratterten, quietschten, über Steine schrammten; Pferde schnauften, Männer schrien.
Selbst im George Davis’ Coffeehouse herrschte Lärm: Hier wurde diskutiert, ein Wort gab das andere, man redete durcheinander. Sir Thomas wurde erkannt, Hände erhoben sich zum Gruß; Blicke senkten sich oder bemühten sich, die Sir Thomas’ zu finden, man nickte ihm zu, lächelte, beugte sich wieder über Bier und Notizen.
»Zeig, was du kannst. Es sollte dir kein Problem sein.« Sir Thomas setzte sich an einen freien Tisch. »Ansonsten habe ich Geld und Zeit vergebens bemüht.« Er hob die Hand für eine Bestellung. »Wir werden nicht lange warten müssen. Nun, bereite alles vor.«
Daryl Dee nestelte an der Tasche seiner Weste, die ein wenig stramm saß, murmelte verlegen einige Worte, und zog eine kleine, längliche Schatulle aus ihr. Er öffnete sie und entnahm zusammenklappbare Augengläser. Ihr Gebrauch war ihm unvertraut, hatte er sie erst vor wenigen Tagen erhalten. Zwei geschliffene runde Gläser wurden mittels eines Scharniers so verbunden, dass man durch diese, einen Steg auf dem Nasenrücken balancierend, schauen und, Daryl fasste es nicht, sehen konnte. Er vermochte zu lesen, erkannte Wörter, überblickte ganze Sätze; er musste nicht mehr Buchstabe für Buchstabe mit einem Lesestein entziffern, den er Zentimeter für Zentimeter über Seiten schob. Nein, jetzt schrieb und las Daryl, ohne zu befürchten, die feuchte Tinte zu verschmieren. Aus seiner Ledertasche zog er nacheinander ein Tintenfässlein in Form einer venezianischen Gondel, einen Federkiel und ein in Leder geschlagenes Notizbuch. Er breitete die Utensilien auf einem Tisch aus. In dem Pub wurden Schicksale verspielt, Menschenleben in Gold aufgewogenMan setzte auf rechtzeitige Ankunft eines Schiffes, auf Verspätung und Untergang; Ladungen, die in fernen Ländern erst erworben werden mussten, wurden heute schon verkauft; man spekulierte mit einbehaltenen Löhnen der Matrosen; auf ihr Ableben wurde gesetzt. Manch einer bot Haus und Hof, um Anteilseigner an hoffnungslos überteuerten und zum Scheitern verurteilten Handelsreisen zu werden.
»So richtet man ein Land zugrunde«, urteilte Sir Thomas. Daryl Dee bemühte sich, einen zerfahrenen, sorgenvollen Eindruck zu machen. In der Nähe seines Großonkels wer-weiß-wievieltenGrades, den er vor dem schrecklichen Unglück kaum je gesehen hatte, fühlte er sich sicher, fürchtete aber durch eine unbedachte Bemerkung dessen Fürsorge zu verlieren.
Unverständnis hatte sich, wenige Tage nach der Katastrophe, in der er seine gesamte Familie verloren hatte, in Daryls Augen und Haltung gezeigt, als im Laden einer erfolglosen Schneiderfamilie, bei der er als billige Arbeitskraft untergekommen war, der merkantile Genius Thomas Gresham auftauchte und ihm, dem früh Verwaisten, Obdach bot.
Die Freude, die sein Verwandter anfänglich über Daryls Anwesenheit empfand, wich einer friedvollen Duldung, um dann, schon wenige Tage später, in einem kaum verhohlenen Abscheu zu münden. Daryl erfüllt die Erwartungen, die Sir Thomas in ihn gesteckt hatte, nicht. Zwar arbeitete er Stunde um Stunde an Formeln, die er mit zusammengekniffenen Augen zu Papier brachte, ergänzte, zu vermeintlicher Vollkommenheit trieb, deren feuchte Tinte er aber alsbald mit seiner Nasenspitze verwischte. »So geht das nicht«, entschied Sir Thomas und schleppte Daryl zu einem Glasschleifer, der ihm eine Augenbryll anfertigte, deren Gläser an dicke Butzenscheiben erinnerten.
Von nun an konnte er lesen und schreiben, sah jeden einzelnen Buchstaben, schrieb schöner als je zuvor - doch all das stellte seinen Onkel nicht zufrieden. Daryl sollte sich an etwas erinnern, auf das er sich nicht besinnen konnte, von dem er nicht wusste, dass er es je kannte. Nach sechs Wochen im Dienste seines Oheims fand dessen verwandtschaftliche Geduld ein Ende. Daryl wurde zum Problem.
Gresham wäre nicht Sir Thomas, der königliche Finanzagent, der mir nichts dir nichts die Niederlande bereiste, die Equipage voller Staatsanleihen des bankrotten englischen Staates, um binnen weniger Wochen mit Gold gefüllten Taschen nach London zurückzukehren, wenn er nicht eine Lösung fände.
Der Name für die Lösung lautete: Pepperjack!
Pepperjack klang verheißungsvoll.
Pepperjack!
Diesen Namen sprach man mit Respekt vor einer alteingesessenen Handelsfamilie aus. Selbst Daryls Eltern, Gott habe sie selig, die außer acht Kindern, von denen eins mehr fraß als das andere, nichts ihr Eigen nannten, kannten und bewunderten die Familie Pepperjack. Und das nicht ohne Grund: